
[Radde, Grundzüge der Pflanzenverbreitung in den Kaukasusländern] Kapitel 6 Abs. II
[p.315:]
II. Meteorologische Verhältnisse in der alpinen Region,
Meteorologisches aus der subalpinen Zone S. 315. Sommerfröste in Hoch-armenien; Verhalten der hochalpinen Flora dagegen S. 316. Temperaturabnahme mit zunehmender Höhe; Stelling's Mittellungen darüber S. 318
Meteorologisches aus der subalpinen Zone. Um eine meteorologische Basis für die subalpine Zone zu gewinnen, bin ich leider nur auf zwei Punkte angewiesen, von denen der eine an der Südseite der Hauptkette, der andere an der Nordseite — beide an der grusinischen Heerstraße — gelegen sind. Es sind die Poststationen Gudaur 2215 m und Kobi 1972 m über dem Meere gelegen, an denen zuverlässige Beobachtungen seit Jahren gemacht werden.
Monats- und Jahresmittel für Oudaur und Kobi./Absolute Maxima und Minima der Temperatur./Mals der Niederschläge in Millimetern. Mittel./ Verteilung der Niederschläge im Verlaufe des Jahres nach Tagen.

In Bezug auf die Temperaturen dürften die erwähnten Zahlen in gleicher Seehöhe für unser ganzes Gebiet annähernd entsprechen, aber mit dem Maße der Niederschläge verhält sich das entschieden anders. Das Jahresmaß derselben in Gudaur und Kobi ist sehr reichlich > es schließt sich direkt an das kolchische mit Ausschluss von S'otschi und Batum und an das von Talysch [p.316:] (Lenkoran). Westwärts von Kobi fällt an der Nordseite, entlang dem Gebirge das Maß der Niederschläge über Alagir (948,6 mm) bis Maikop (674 mm) schon auf fast die Hälfte. Ostwärts ermittelte man bei Wedensk 740 m Höhe 845,5 mrn> nur wenig mehr als bei Wladikawkas (826,3 mm) unmittelbar vor Kobi am Fuße des Gebirges gelegen. Alle die Basis des östlichen Kaukasus beiderseits umzingelnden meteorologischen Stationen weisen viel geringere Jahresregenmengen auf, als sie für die beiden hochgelegenen Plätze ermittelt wurden, so Achty am S'amur 355,4 mm, Chunsach 547 mm, Temirchan-schura 436,8 mm, Grosny 513,1 mm, Petrowsk 423,1 mm, Kusari 388,1 mm, Derbent 408 mm, Baku 247mm, Schemacha 485mm, Nucha 716,7 mm, Sakatali, 855,1 mm, S'ignak 675,8 mm, Telaw 700,8 mm, Tiflis 489 mm, Gori 535,1 mm. Nicht anders verhält sich das am Fuße des Randgebirges. In Artwin fallen 602,1 mm; in Abastuman, unmittelbar am Südfuße der adsharo-imeretischen Scheide gelegen, 62i,9mm, in Achalzich 506,8 mm, in Borshom 617 mm, endlich in Jelisabethpol nur 256,9 mm Regen im Jahre. Noch krasser stellt sich die Abnahme der Niederschläge südwärts voni Randgebirge auf dem armenischen Hochlande heraus. In Aralych (790 m Seehöhe) unmittelbar am N.-Fuße des Großen Ararat erreicht der Regen im Verlaufe des Jahres nur 158,1 mm, das Minimum, welches überhaupt auf dem weiten Gebiete unserer Untersuchungen fällt und welches nur noch am Ostufer des Kaspi in Usun-ada mit 71 mm (Minimal) und in Fort Alexandrowsk mit 123 mm Jahresniederschlag übertreffen wird, während Krasnowodsk mit 166 mm ein kleines Plus aufweist.
Stellen wir zu dem Extrem von Aralych noch von einigen anderen Orten Hocharmeniens die jährlichen Regenmengen zusammen, so bestätigen diese das vorher Gesagte. So hat Kars bei 1742 m Höhe nur 455,9 mm Niederschlag, Kagisman 290,5 mm, Alexandropol 380,7, Eriwan 344,4mm. Am Südrande des großen Goktschai-Sees in Nowo-Bajaset steigt der Niederschlag auf 474,5 mm und vermehrt sich am Ostrande von Karabagh in Schuscha (1368 m) bis auf 658,9 mm, um dann rapide gegen Osten in der Senkung der Mugan zu fallen und erst südlich unter dem Einflüsse des hohen Alburs-Systems in der Maximalhöhe 1188 mm zu erreichen.
Sommerfröste in Hocharmenien; Verhalten der hochalpinen Flora dagegen. Ich darf von den meteorologischen Erörterungen über die beiden alpinen Vegetationszonen noch nicht scheiden und mit den Special-schilderungen der Flora beginnen, bevor ich nicht Folgendes erledige.
Das armenische Hochland, mehr als irgend ein anderer Teil unseres Gebietes, weist die extremsten meteorologischen Verhältnisse auf, denen sich die Flora anpassen muss. Diese breiten Temperatur-Amplituden von 60—72° C. im Vereine mit der Trockenheit der Luft, konnten nur einer äußerst widerstandsfähigen, ausdauernden Flora passen, welcher dadurch ein ganz besonderer Stempel in ihren charakteristischen Formen verliehen wurde. Ist das schon in den tieferen Regionen der Fall, wo Wald und Steppen verschwinden und an ihre Stelle ein Heer von Xerophil-rupestren mit durchweg fremdartigem Habitus, mit originellem Bau, starrer Bewaffnung etc. treten, so findet Gleiches auch [p.317:] in den beiden alpinen Zonen statt. Selbst für die subalpinen Gebiete liegen Fa:ta vor, die man sich ohne eingehendes Studium an Ort und Stelle, zu welchem der Reisende weder Zeit noch Mittel hat, nicht erklären kann. Schon der Chevalier TOURNEFORT beklagt sich am 19. und 22. Juni des Jahres 1701 über Schnee und Kälte, es fror damals über Nacht zwei Linien dickes Eis. MALAMA erwähnt für 1855 in der Nacht vom 23. bis 24. Juni die Kälte von 5° R.! Entweder sammelte jener Gelehrte zu Anfang des 1 8. Jahrhunderts in dei Ebene von Erzerum (reichlich 1830 m [6000 r. F.]), oder in ihrer subalpinen Unrandung. Wie blieb denn die Flora dieser Ebene in den Nächten des 19. und 22. Juni vom Frost verschont, welcher mit einer Eisdecke das Wasser im Kübel überzog, in dem die gesammelten Pflanzen standen ? Am Bingöl-dajh, welchem Euphrat und Araxes entspringen, erlebte ich Folgendes: Wir nächtigten in ca. 2 740 m auf geschlossenem alpinem Carex- und Festuca-Rasen , er war zwar weich, aber sehr kalt, wir froren ohne Feuer Nadits, die Temperatur mochte wohl bis auf o° gefallen sein. Höher am Rande des Kraters, ganz nahe am ewigen Schnee blühten trotzdem viele sdöne Pflanzen, so Taraxacum crepidiforme , Helichrysum aurantium, Astra-galus talyschensis , Nepeta Mussinii, Scrophularia pyrrholopha, Oxyria reni-fomis, Cerastium araraticum, Potentilla argaea, Centaurea cana, C. concinna, Viola dichroa etc. und zwei saftige Umbelliferen: Anthriscus nemorosus und Heracleum incanum standen in den Vertiefungen des dunkeln Andesit- und Trichyt-Chaos, welches sich seitwärts vom Krater hindehnte. Wie überdauern die saftigen Arten, so auch die beiden Umbelliferen, die häufigen Nachtfröste? Vom Großen Ararat kann ich ein noch auffallenderes Factum erwähnen. Bei scher Besteigung von N. her am 21. August 1871 (mit Dr. G. SlEVERS) in deiselben Richtung, welche PARROT 1829 einschlug, fanden wir am kleinen Trichtersee Küp-göl, der etwas östlich vom Gletscherfuß der N.-Seite gelegen ist (3433 m) noch schönen Festuca-Rasen und i Fuß hohes Hedy-sarum obscurum in voller Blüte. Festuca und Carex decken auch hölier noch als feste Narbe das Steilgehänge, dann folgten die ge-tremten Hochalpinen und in 4176 m (13703 r. F.) die Schneelinie. Man sollte meinen, nur bis zu dieser gebe es Phanerogamen. Dem ist aber nicht so. Die letzten Zwerg-exemplafe von Pedicularis araratica und Draba araratica wurden mitten im Firn auf entblößter Felszinne in 4420 m (14500 r. F.) Höhe mit reifen Samen gefunden. Das waren also zwei supranivale Arten in so großer Höhe. Als wir aber bei unserer weiteren Wanderung, immer am Nordgehänge

[p.318:] des Großen Ararat am 22. August in ca. 3050 m nächtigten, fror es über Nacht so stark, dass am Morgen überall die Schmelzwasser des Tages gefroren- waren und wir das Eis zum Theekochen im Kessel auftauen mussten. Sowohl am Bingöl-dagh als auch hier an der Nordfront des Großen Ararat wäre unser alpines Notlager wärmer gewesen, wenn wir es nicht auf dem die Wärme schlecht leitenden .Carex- und Festucarasen, sondern, auf nacktem Felsen genommen hätten. parrot hat diese Erfahrung gemacht. Am 26. und 27. September 1829 schlief er in Höhe von 13036 Pariser Fuß im Freien auf ödem Felsenlager ohne Pelz und zwar, wie er schreibt, ganz behaglich (PARROT's Reise zum Ararat I pag. 187).
Welche Minima von Temperatur mussten die beiden erwähnten zierlichen Pflänzchen in 4420 m (14500 r. F.) Meereshöhe wohl ertragen können, um etwa im Verlaufe von 6 bis höchstens 8 Wochen zu treiben, zu blühen und Samenschötchen zu reifen?
Temperaturabnahme mit zunehmender Höhe; Stelling's Mitteilungen darüber. Ich wendete mich mit dieser Frage an einen Specialisten, Herrn STELLING, damals Direktor des physikalischen Observatoriums in Tiflis, um zu erfahren, ob man wohl aus den Temperaturen etwa von Eriwan oder Aralych die Mittel und Extreme für 4420 m mit einiger Sicherheit ableiten könne. Leider ist das nicht möglich. Ich lasse hier die darauf bezüglichen Mitteilungen des Herrn STELLING folgen.
Tabelle über die Abnahme der Temperatur in der Vertikalen vom Spiegel des Meeres bis zu 2100 m im Verlaufe der Monate und des Jahres.
Abnahme der Temperatur mit der Höhe.
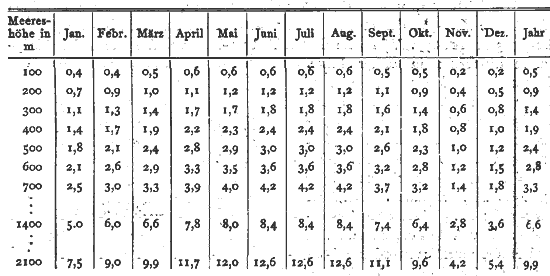
Über diese letztere Höhe hinaus wird die Reduktion schon recht unsicher, da sie hier zum Teil auf Extrapolation beruhen würde.
Als Beispiel führe ich einen Vergleich zwischen den in Gudaur direkt beobachteten Temperaturen und den nach den Tifliser Beobachtungen inter- [p.318:] polierten entsprechenden Werten aus. Nach den Beobachtungen von 1888 bis 1892 betrug die mittlere Temperatur in Tiflis:

/Für die zwischen Tiflis und Gudaur bestehende Höhendifferenz von 1800 m giebt die Tabelle folgende Reduktionsgrößen:/ Für eine Seehöhe von ca. 2200 m können wir daher in der Breite von Tiflis folgende Temperaturen erwarten: // Fügen wir zu diesen Werten noch die (etwas unsichere) Temperaturänderung mit der Breite hinzu://
so erhalten wir für Gudaur nachstehende interpolierte Temperaturen: //dagegen haben die in Gudaur angestellten genauen Beobachtungen in den Jahren 1888—92 die folgenden mittleren Temperaturen ergeben: //Die Differenzen zwischen den beobachteten und den nach Tiflis berechneten mittleren Temperaturen betragen somit:
Mit Ausnahme der beiden letzten Monate sind die Differenzen positiv (d. h. die berechneten Temperaturen sind meist um ½ ° zu niedrig, doch kann mit Rücksicht auf die große Entfernung und die verschiedene Lage der beiden Orte die Übereinstimmung als befriedigend gelten.
Die Daten der Reduktionstabelle gelten aber im Allgemeinen nur für mittlere Zustände und können daher bei exceptionellen und außerordentlichen Umständen, unter denen die absoluten Extreme der Temperatur einzutreten pflegen, nur mit der größten Vorsicht benutzt werden. Bei Anticyclonen tritt namentlich im Winter häufig sogar eine vollständige Umkehrung der [p.320:] Temperaturverteilung in der Vertikalen ein, so dass dann bis zu recht bedeutenden Höhen die Temperatur mit zunehmender Höhe sogar recht bedeutend wächst; unter solchen Verhältnissen ist an eine Reduktion der in der Tiefe beobachteten Temperaturen natürlich nicht zu denken. Die Folge davon ist, dass die reducierten Minimaltemperaturen im Winter jedenfalls zu niedrig ausfallen müssen. Ferner ist auch von vorn herein zu erwarten, dass die Maximal-und Minimaltemperaturen namentlich auf Berggipfeln näher bei einander liegen als in der Ebene: die Amplituden der Temperaturschwankung nehmen mit der Erhebung ab; hierbei spielen zudem die topographischen und anderen Lokalverhältnisse eine wesentliche Rolle, so dass jedenfalls Thalboden mit Thalboden und Anhöhe mit Anhöhe zu vergleichen sind.
Aus diesen Gründen giebt es keine allgemeinen Regeln für die Reduktion der Extremtemperaturen auf ein höheres Niveau.
Wir wollen indessen im Nachstehenden den Versuch machen, die. in Tiflis beobachteten höchsten und niedrigsten Temperaturen nach den mittleren Daten auf Gudaur zu reducieren und das Resultat mit den dort direkt beobachteten Extremtemperaturen zu vergleichen; natürlich sind für beide Stationen die gleichen Jahrgänge zu benutzen.
In Tiflis betrugen die absoluten Maxima für die Jahre 1888—1892:

Benutzen wir zur Reduktion auf Gudaur wie oben// so hätten wir in Gudaur folgende Maximaltemperaturen zu erwarten:// In den Jahren 1888—1892 wurden aber in Gudaur nachstehende höchste Temperaturen beobachtet:// Die Differenzen zwischen den nach Tiflis berechneten und den direkt beobachteten Maximaltemperaturen betragen somit:
Die größeren Differenzen in der kälteren Jahreszeit entsprechen den ausgesprochenen Erwartungen; dagegen ist die Übereinstimmung zwischen Berechnung und Beobachtung vom April bis September eine auffallend gute. [p.321:]
Für die Minimaltemperaturen erhalten wir folgendes Resultat:

Die großen positiven Differenzen im Dezember und Januar waren vorauszusehen, nicht aber die großen negativen Werte im März und November; die Differenzen in der Zeit vom April bis September sind ganz unerwartet klein.
In der wärmeren Jahreszeit haben sich also sowohl für die Maxima als auch für die Minima der Temperatur sehr gute reducierte Werte ergeben; es bleibt aber immerhin sehr fraglich, ob an anderen Orten und unter anderen Verhältnissen das Resultat ein ebenso günstiges sein wird. Bei Punkten, deren Seehöhe viel über 2000 m beträgt, dürfte schon die Ableitung der mittleren Temperaturen ein unsicheres Resultat liefern, auf welches sich keine weitergehenden Schlüsse aufbauen lassen; von einer Extrapolation der Extremtemperaturen in solchen Höhen glaube ich aber entschieden abraten zu müssen.
|
6. Hochgebirgsflora der Kaukasusländer. |